...und dann wurden wir Yoga Teacher. So wie alle.
- Mirjam Bollinger
- 28. Apr. 2024
- 10 Min. Lesezeit
„Was hältst du davon, ein Yoga-Teacher-Training zu machen?", frage ich Patrick als wir
durch den Gebetsmühlenweg zum Sitz der tibetischen Exilregierung spazieren. Er schaut mich an, dann prusten wir los. Ich habe Patricks Nerv getroffen: Kaum jemand kann sich so über szenige Menschen in Yogaausbildung lustig machen, wie Patrick. „Heute ist doch jeder und jede Yogalehrer und Yogalehrerin", pflegt er seine Spötteleien stets zu beenden. Seit sich Patrick vermehrt mit seiner Gesundheit auseinandersetzt, verschiedene Therapieformen ausprobiert, zu meditieren begann und wieder regelmässig Sport treibt, hat auch das eine oder andere Asana Einzug in sein Training gehalten. Yoga selbst steht er also ganz und gar nicht ablehnend gegenüber; vielmehr nervt ihn der Hype um Yoga und Spiritualität. Mir geht es ähnlich. Und dennoch: Seit zwei Tagen besuchen wir die morgendliche Yogalektion von Satya, einem hinduistischen Yoga-Guru und Priestersohn. Ja, ich gebe es zu: Ich war diejenige, die es mir nicht verziehen hätte, im Ursprungsland der Asanas keine Yogaschule aufzusuchen. Und da Patrick leicht zu begeistern ist, kommt er mit.
Als wir uns vom Lachanfall erholt haben, hake ich nach: „Im Ernst, das wäre doch witzig.
Jeden Tag Training, in Hinduismus, Meditation und Yogaphilosophie eintauchen, einen Monat hier im Himalaya verbringen, wo wir dem Dalai Lama so nah sind." Mir gefällt Himachal Pradesh unglaublich gut. Eigentlich wollten wir in Rishikesh eine Pause einlegen; die beliebte Stadt am Ganges hat uns jedoch enttäuscht. Inmitten der hinduistischen Pilgerstadt tummeln sich zahlreiche spirituelle Backpacker, Sinnsuchende und Hipster, die auf den Spuren der Beatles einige Tage in Ashrams verbringen. Auch Abenteurer kommen auf ihre Kosten: am Ufer des Ganges drängen sich unzählige Riverraftig-Anbieter während in den Wäldern der Umgebung Ziplining und Bungee Jumping angeboten wird. Nach drei Tagen haben wir den Ort satt. Unsere Weiterreise führt uns nach Himachal Pradesh, wo wir die Ruhe und Abgeschiedenheit der winzigen Dörfer geniessen. Im Parvati-Tal wandern wir bis zur Schneegrenze oder geniessen die Nachmittage schreibend und zeichnend in kleinen Cafés, schlemmen uns durch tibetische Spezialitäten und lassen uns massieren; die Abende verbringen wir mit Raj, unserem Gastgeber. In McLeod Ganj verlieben wir uns sofort. Das Städtchen ist zwar überschaubar, es bietet aber eine Vielzahl an Entdeckungen und ist dabei wahnsinnig entspannt. Da die tibetische Exilregierung hier ihren Sitz hat und der Dalai Lama residiert, lebt eine grosse tibetische Minderheit in der Region. Bereits zwei Monate zuvor tauchten wir in Darjeeling zu ersten Mal tiefer in die tibetische Geschichte und Diaspora ein: beim Besuch eines tibetischen Museums, in Tempeln und als wir in einem Flüchtlingszentrum nach dem Lesen der bewegenden Geschichten von Flucht und Vertreibung einer alten Frau bei der Herstellung von Momos über die Schultern schauen durften. In McLeod Ganj nun lauschen wir während einer Long Live Offering Ceremony dem Dalai Lama, währenddem uns Mönche Buttertee und Dresi reichen. Wir besuchen tibetische Tempel, Museen und lassen uns von einem Heilpraktiker behandeln. McLeod Ganj fühlt sich an, als wären wir für einen Moment angekommen.
Als wir wenige Tage später im Nachbarsdorf ein kleines Zimmer bei einer indischen Familie beziehen, bin ich ein wenig aufgeregt. Wir haben uns tatsächlich für die Yogaausbildung entschieden. Am nächsten Morgen sitzen wir nach einem grossen Früchte-Frühstück bei Satya. Heute werden wir rituell willkommen geheissen, gesegnet und bekommen unsere Kursunterlagen. Fortan wird ein Hausaltar mit Shiva und Ganesha in unserem Zimmer stehen, den wir jeden Tag mit Gangeswasser benetzen und mit frischen Blütenblättern dekorieren sollen. Alltägliche Rituale werden wir noch zur Genüge kennenlernen; sie sind unumgänglich im Leben eines gläubigen Hindus. Die erste Morgenstunde werden wir im kommenden Monat mit Chakra-Meditationen verbringen, wir werden uns durch endlose Verse aus den Veden singen und Rezitationen von Mantras und Gebeten lernen, währenddem wir Japa Malas durch unsere Finger gleiten lassen. Danach folgen zwei Stunden Hatha-Yoga. Auf dem Yoga Deck finden sich immer zwischen zehn bis zwanzig Schülerinnen und Schüler ein, wobei nur Ines - eine junge Portugiesin - und wir in der Ausbildung sind. Ich liebe das Morgenyoga. Satyas ruhige Art und der Aufbau der Lektionen - wir starten jeweils mit einem ausgiebigen Pranayama (Atemübungen) - schaffen im Nu eine meditative Stimmung, die es mir ermöglicht, mich ganz auf mich und die Asanas zu konzentrieren. Ich habe während meines Studiums manchmal Yogalektionen vom Unisport besucht und obwohl sie einen idealen Ausgleich zum kopflastigen Unialltag boten, konnte ich mich in den hässlichen, überfüllten Räumlichkeiten nie ganz mir selbst widmen. Hier, auf dem offenen Deck, hört man die Vögel, das Plaudern unserer Gastfamilie und das Muhen der Kuh vor dem Stall. Ich kann den Wind fühlen oder die Sonne auf meiner Haut. Und ich rieche den Regen, den Ziegenmist oder den Duft der frischen Chapatis, die Grossmutter gebacken hat. Spätestens ab der zweiten Woche - als unsere Anatomielektionen bei Vaibhav angefangen haben - beginne ich, die Asanas zu variieren, zu korrigieren und verstehe plötzlich, woher meine Schmerzen in der rechten Schulter und im Ischiasnerv kommen. Das Mittagessen nach dem Training ist Patricks Tageshighlight: Big Mama, eine Frau aus dem Dorf, kocht die besten Thalis für uns. Jeden Tag essen wir Gemüseeintopf mit Linsendhal und Chole, Chutney, Raita, Reis und Chapati. Manchmal kocht Big Mama Malai Kofta, manchmal Palak Paneer oder Curries.
Aber jedesmal ist das Essen wunderbar. Satya, Ines, Patrick und ich sitzen stets vor unseren Zimmern auf einem Teppich und essen mit den Händen bis wir satt und zufrieden sind. Der Nachmittag ist für Yoga-Philosophie reserviert. Die erste Stunde widmen wir uns Schriften der Vedanta; die heute populärste Richtung innerhalb der vedischen Philosophie. Gemeinsam arbeiten wir uns durch die Bhagavad Gita, eine der zentralen Schriften des Hinduismus. Meinem geisteswissenschaftlichen Studium ist es zu verdanken, dass mir der Umgang mit antiken Grundlagentexten, Quellen oder philosophischen Auseinandersetzungen wenig Mühe bereitet. Ich freue mich sehr, endlich wieder einmal ein Seminar zu besuchen, in welchem über philosophische Texte diskutiert wird. Daher ist wohl meine Enttäuschung umso grösser, als sich herausstellt, wie wenig Diskussionen - geschweige denn Kritik - erwünscht sind, wie dogmatisch unterrichtet wird und wie strenggläubig Satya eigentlich ist. Grundkonzepte des Yoga wie Karma und Reinkarnation, das hinduistische Gottesbild, der Yogapfad, die vielen Einteilungen in verschiedene Körper und Körperschichten, Chakras, moralische Gunas, Elemente, Farben und so weiter interessieren mich; aber auf einer wissenschaftlichen Ebene. Ich möchte verstehen, wie die Konzepte entstanden sind, worauf sie basieren und wie sie die indische Gesellschaft aktuell prägen. Ich möchte Parallelen und Unterschiede zur „westlichen" Gesellschaft feststellen, zum christlichen Gottesbild, zur abendländischen Philosophie. Schnell wird klar: Ich muss die ganze Transformationsarbeit selbst leisten, denn ich sitze nunmal nicht in einem Seminar an der Uni. Satya kann uns Konzepte und Geschichten zwar wiedergeben, er kann uns aber weder Hintergründe, Entstehungsgeschichte oder Zusammenhänge präsentieren. Denn: Für ihn ist die hinduistische Lehre die unumstössliche Wahrheit.
Auch die nachfolgende Lektion - Tantra-Philosophie - wird im gleichen Stil durchgeführt. Sie interessiert mich zwar wesentlich weniger; da mir die Einteilung des Göttlichen in die Dualität von Weiblich und Männlich sowieso obsolet scheint (die Tantra-Philosophie fokussiert sich auf die Verehrung weiblicher Gottheiten). In diesen Lektionen werde ich mich dafür oftmals mit grossen Augen, offenem Mund oder der Unsicherheit - entweder laut loszulachen oder mich irritiert zurückzuziehen - wiederfinden. Satya unterrichtet uns in esoterischen Werken, wobei wir anhand der zehn wichtigsten Göttinnen (Mahavidyas) Gebete, Mantras, Zauberformeln, Opfergaben und komplizierte Rituale kennenlernen. Im Tantrismus ist man für jede Lebenslage mit einer Vielzahl von magischen Praktiken ausgestattet. Unwillkürlich muss ich an den Hexenhammer denken, das spätmittelalterliche Werk des deutschen Inquisitors Heinrich Kramer. Zwar diente das Buch der Hexenverfolgung und nicht wie in Indien der Verehrung weiblicher Gottheiten. Dabei werden allerdings in ähnlichem Stil magische Praktiken, Exorzismen, Wetter- und Schadenzauber beschrieben. Bis heute - als ich diese Zeilen schreibe - kann ich nur Staunen, wie Menschen aus solchen Werken Wahrheit ziehen.
Und dennoch: Vor 25 Jahren war auch meine Welt vom Glauben an eine uralte Textsammlung und übernatürliche Wesen geprägt. Ich wuchs in einer Familie auf, die eine Freikirche besuchte. Meine ersten Erinnerungen an Kinderbibeln, Gottesdienste und evangelikale Events sind ambivalent. Einerseits liebte ich bereits als Kind Geschichten, Musik und Theateraufführungen. Andererseits stellten Gruppen und Gruppendynamiken schon damals eine gewisse Bedrohung für mich dar. Vielleicht nur, weil ich mich in den Kindergottesdiensten mit so vielen Kindern verstehen musste, die ich eigentlich komisch fand. Ja, ich war ein wählerisches Kind, wenn es um soziale Kontakte ging. Vielleicht auch, weil ich die Stimmung in der evangelikalen Gemeinschaft als sehr moralisch wahrnahm: Ständig bewegte man sich als Individuum auf der Schwelle zwischen Gut und Böse. Die Welt wurde in Schwarz-Weiss gemalt. Und der Mensch war böse, weshalb ich mir schon früh darüber Gedanken machen musste, wo ich in meinem kindlichen Alltag sündigte. Für mich stellten Hölle und Teufel eine reale Angst dar; egal wie oft in der Sonntagsschule gesagt wurde, dass Gott stärker als der Teufel sei. Mit Einflüssen der charismatischen Erweckungsbewegung hielten seltsame Rituale Einzug in den Gottesdienst: Handauflegen, Zungenrede, prophetische Visionen und Missionsbestrebungen. Ich weiss noch, wie verstört ich anfangs war, als bei Gottesdiensten von Walter Heidenreich - eine Koryphäe unter den deutschsprachigen Evangelisten - Menschen plötzlich zu zucken, zu schreien und zu weinen begannen. Bis es irgendwie normal wurde.
Als ich mitten in der Pubertät steckte, brachen in der Freikirche Unstimmigkeiten über den bisherigen Führungsstil aus. Meine Eltern wünschten sich flachere Hierarchien und eine grössere Mitsprache. Somit gehörten sie - und eine Handvoll anderer Familien - zu den Abtrünnigen, die schliesslich mehr schlecht als recht eine neue Gemeinde gründeten. Diese Krisenphase, die zeitgleich in die vulnerable Phase meiner Pubertät fiel, veränderte unwiderruflich sowohl meine Sichtweise auf religiöse Institutionen, als auch mein Gottesbild. Ich empfand plötzlich alle Christen als ultimative Heuchler und fing die Freikirche an zu hassen: immerhin sah ich sie als verantwortlich dafür, dass sich Mami und Papi wenig später in einer Ehekrise befanden. Auch wenn sich meine Eltern schliesslich für einander und gegen sämtliche Freikirchen entschieden, weiss ich, dass der jahrelange Prozess viele Desillusionen, Enttäuschungen und Verletzungen hinterliess. Natürlich auch bei mir. Bei meiner grossen Neugier anderer Lebensweisen gegenüber, bei aller Toleranz und Unterstützung von Minderheiten; wenn es um religiöse Institutionen - allen voran aus der evangelikalen Ecke - geht, sehe ich meine Toleranz schwinden. Ironischerweise triggert mich dabei vor allem der alleinige Wahrheitsanspruch und die damit zusammenhängende Intoleranz. Aber: Kann es richtig sein, Intoleranz mit Intoleranz zu begegnen?
Heute gehe ich versöhnlicher mit meiner Familiengeschichte um. Unsere Reise, die Auseinandersetzungen mit mir selbst und mit meinen Eltern haben mich nachsichtiger gemacht. Ich bin dankbar für so manche Werte, die meiner Schwester, meinem Bruder und mir mit auf den Weg gegeben wurden. Und ich weiss, dass meine Eltern stets versuchten, ihr Bestes zu geben. Dennoch bedeutet es für mich noch immer Stress, mich dogmatischen Lehren und Menschen aussetzen zu müssen. Oftmals gestalten sich auch Gruppenaktivitäten als schwierig, die jenseits von Freund- oder Wissenschaften stehen. Es kommt vor, dass ich mich in einer Sport- oder Kreativgruppe extrem unwohl fühle, weil sich plötzlich alle so „gleichgeschaltet" verhalten. Und da ich sehr feinfühlig bin, was Gruppendynamiken anbelangt, bescherte mir dies den einen oder anderen Selbstausschluss. „Welch perfekte selbsttherapeutische Umgebung bietet da ein Monat Yogaausbildung in Indien", lachte ich noch, als Patrick und ich darüber diskutierten, ob wir die Ausbildung antreten sollen oder nicht. Nun aber - am zweiten Nachmittag bereits - bin ich so frustriert, dass Patrick vorschlägt, abends mit Satya das Gespräch zu suchen.
Im anschliessenden Yogatraining lässt mein Unmut ein wenig nach. Dank Joni und Tess, unseren Lehrerinnen am Nachmittag, lernen wir in den nächsten Wochen auch Vinyasa und Yin Yoga kennen. Jonis Lektionen sind herausfordernd für mich, weil sie auf Kraftaufbau fokussiert; bei Tess' Lektionen hingegen steht Flexibilität im Vordergrund
Die beiden ergänzen sich wunderbar.
Nach Big Mamas Abendessen treffen wir uns entweder in Satyas Zimmer, wo er uns in mystische Meditationsriten einweiht oder auf dem Yoga Deck. Dort singen wir - zusammen mit anderen Kirtans - spirituelle Lieder - während wir von Harmonium oder Gitarre begleitet werden (ja, auch an dieser Stelle kommen sie hoch, die Erinnerungen an freikirchliche Hauskreise...). An diesem Abend sind wir nur zu viert, weswegen wir meditieren. Ich bin froh darum, weil sich nun die Gelegenheit ergibt, mit Satya offen zu kommunizieren. Sowohl Patrick als auch ich erzählen von unseren unterschiedlichen Erfahrungen mit Religion beziehungsweise religiösen Institutionen. Wir legen Satya unsere Motivation für die Ausbildung offen: einen Einblick in Hinduismus und Yogaphilosophie zu bekommen, ohne dabei einen Glauben oder gar eine Religion zu übernehmen. Patrick macht deutlich, dass ihn vor allem die sportliche beziehungsweis anatomische Perspektive interessiert. Und auch wenn Satya kaum auf uns eingehen kann (er erklärt uns unentwegt, dass Hinduismus aber keine Religion, sondern die Wahrheit sei; auch diese Argumentation ist mir mehr als bekannt), tut es gut, ehrlich unsere Standpunkte klargemacht zu haben.
Nun liegt es an mir. In den nächsten Wochen begebe ich mich auf eine Reise, die ausserhalb meiner Komfortzone liegt. Erstaunlicherweise stresst mich das Yogatraining in der Gruppe kaum. Schwieriger sind Philosophie- und Kirtanstunden; vor allem wenn Teilnehmende dabei sind, die Satya Ehrfurcht und Bewunderung entgegenbringen. Dann ändert sich sowohl seine Stimme, als auch seine Gestik und Mimik. Und wir beobachten verstört, wie gross er sich und seine Aussagen macht und wie manipulativ er wird. Zu Beginn ärgere ich mich sehr darüber. Nach und nach lasse ich die Verantwortung aber dort, wo sie hingehört: bei den Teilnehmenden selbst, die sich manipulieren lassen. Immer häufiger können wir darüber lachen und Satya lässt uns Freiheiten, weil er wohl merkt, dass wir sowieso unseren eigenen Weg gehen. Patrick lässt die Philosophiestunden öfter mal sausen; im Yogatraining und in Anatomie gibt er dafür alles. Ich beginne, selbst Interpretationen der Bhagavad Gita oder Patanjalis Yogasutra zu lesen und tausche mich mit Gleichgesinnten aus - sei es vor Ort oder mit Freundinnen aus der Schweiz. Und war der Tag zu voll mit dogmatischer Lehre, kaufen wir uns im kleinen Laden um die Ecke eine Flasche Apfelwein.
Das erste Wochenende unternehmen Satya, Ines, Patrick und ich einen Ausflug ins Barot-Tal, ein Tal, das laut Satya besonders heilig sein soll. Wir spüren zwar nicht viel davon, aber es tut gut, gemeinsam Zeit zu verbringen; jenseits von Yoga. Als Person mögen wir Satya: Er ist sehr feinfühlig, hilfsbereit und grosszügig. Wir helfen ihm gerne, sei es beim Sauberhalten des Yoga Decks, beim Pflanzengiessen oder Organisatorischem.
Nach zweieinhalb Wochen feiern wir Ines‘ Zertifizierung; sie hat die Ausbildung vor uns begonnen. Danach werden Patrick und ich immer öfter ins Unterrichten einbezogen.
Zuerst helfen wir, die Teilnehmenden bei den Asanas zu unterstützen, dann unterrichten wir uns gegenseitig. Die letzte Woche vor unserer eigenen Zertifizierung dürfen wir jeweils die Nachmittagslektionen leiten. Satya lässt uns freie Hand.
Den Tag vor unserer Abreise verbringen wir im Corner Café bei unserem Freund Pankaj, der die besten Cappuccinos braut und Croissants bäckt. Dharamkot ist so klein, dass man seine Nachbarn nach einem Monat kennt. Während Patrick Armbänder für unsere neuen Freunde knüpft, bastle ich am Traumfänger für Satya. Dabei denke ich an den Tag unserer Zertifizierung zurück. Bei Kaffee, Kuchen und Blumen überreichte uns Satya unser Zertifikat, gab uns Ratschläge, Segenswünsche und unsere persönliche hinduistische Gottheit mit auf den Weg. Patrick leitete das Nachmittagsyoga und am Abend stiessen wir auf dem Deck mit Rum Cola an, während der Vollmond hell am Himmel stand. Übermütig erfanden wir eigene Vollmond-Asanas und sangen selbstgedichtete Mantras. Ein wenig stolz war ich schon, dass ich den Monat - aller Trigger zum Trotz - durchgehalten habe. Und Patrick, der weiss noch immer nicht genau ob er sich freut, dass er das Klischee „Alle sind Yogateacher" nun auch erfüllt.




































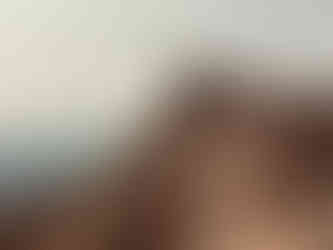





































































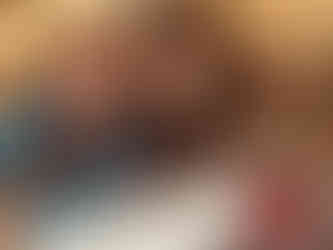


















Kommentare