Auf den Spuren Siddhartas
- Patrick Sprecher
- 17. Apr. 2024
- 8 Min. Lesezeit
Die ersten Sonnenstrahlen erhellen langsam den klaren Himmel über Pai, während ich mich in der kühlen Morgenluft auf die Wartebank eines Bushäuschens setze. Nach kurzer Zeit nimmt ein etwa 40-jähriger Mann neben mir Platz. Kaum haben wir uns begrüsst, beginnt er, mir seine Lebensgeschichte zu präsentieren, währenddem er im Minutentakt Finger, Hals und Beine verrenkt, bis es knackt. Er sei Yoga-Lehrer, Heilpraktiker, Meditationstrainer und ich merke schnell, dass wir heute dasselbe Ziel haben: Das Waldkloster Wat Pa Tam Wua im Norden Thailands, welches für Touristen offen steht, damit sie dort in die Welt der Meditation und des Buddhismus eintauchen können. Halbverschlafen lasse ich den esoterischen Vortrag über mich ergehen und streue des Anstandes wegen ab und zu ein ‚Aha‘ oder ein ‚Ok‘ ein. Nach einer Stunde des Wartens geben wir auf; der Bus soll heute wohl nicht kommen. Ich schlendere durch das verschlafene Dorf, setze mich in ein Café und warte, bis am Mittag der nächste Bus fährt. Während ich versuche, mich an der dampfenden Tasse zu wärmen, habe ich Zeit zum nachdenken. Und wie es so ist, wenn ich mir zu viele Gedanken mache, bin ich nahe dran, mein Vorhaben schon auf der Hinreise abzubrechen. Werden da alles so selbstverliebte Möchtegern-Gurus sitzen, die wissen, wie der Hase läuft? Leute, die die Welt verstanden haben und alle anderen belehren was richtig und was falsch ist? Die Aussicht fünf Tage für mich zu haben und die Ruhe zu geniessen, stimmt mich grundsätzlich freudig. Allerdings werde ich ebenso skeptisch, wenn ich mich auf Reise-Blogs durch die Bilder des Klosters klicke: Etwa hundert Leute, von Kopf bis Fuss in Weiss gekleidet, sich im Gänsemarsch hinterherschreitend oder in einer Halle vor einem goldenen Buddha kniend - betend. In meinem Kopf tun sich Assoziationen an skurrile Sekten auf. Seit jeher habe ich eine Ablehnung, was Religionen betrifft. Dass Leute uralten, zusammengetragenen Geschichten aus einem Buch folgen, diese als die einzig richtige Wahrheit ansehen und daraus ihr Handeln begründen oder rechtfertigen, konnte ich noch nie verstehen. Genau das ist aber auch ein weiterer Grund für mich, diese Gelegenheit wahrzunehmen: Um mich aus meiner Komfortzone zu wagen und vielleicht zu verstehen, warum Menschen Religionen folgen oder wie sie Kraft aus religiösen Ritualen schöpfen.
Der nächste Anlauf ins Kloster zu kommen, stimmt mich zuversichtlicher. Neben mir nimmt ein sympathischer Amerikaner Platz. Wir sprechen die ganze Fahrt über kein Wort, nur, als ich mir bei einem kurzen Halt einen kleinen Snack besorge (sollte es im Kloster doch erst zum Frühstück wieder etwas zu Essen geben), meint er, dass das wohl eine gute Idee sei und schliesst sich mir an. Beim Tempelkomplex angekommen, schreiben wir uns in ein dickes Buch ein, werden mit Wolldecken und weissen Kleidern eingedeckt und in ein Zimmer eingeteilt. Josiah, der junge Amerikaner vom Bus, wird mein Bettnachbar. Bald darauf steht die erste „dhamma talk and meditation class“ auf dem Programm. Alle schnappen sich ein Singbuch und ein Sitzkissen und versammeln sich in der offenen Halle. Als Neuling versuche ich bei den anderen abzuschauen. Die ganze Gemeinschaft hält synchron die Hände vor die Brust und spricht im Chor monoton klingende Laute auf Thailändisch. Ohne den Sprechgesang zu unterbrechen, wird in regelmässigen Abständen vom Schneidersitz auf die Knie und zurück gewechselt und sich jeweils verneigt, wenn ‚bow down‘ gesagt wird. Ich bin sehr irritiert und in mir regt sich Widerstand. Ich kann und will nicht folgen. Das Ganze dauert etwa eine halbe Stunde. Danach folgt die Gehmeditation. Der bereits erwähnte Gänsemarsch fühlt sich gut an. Barfuss spazieren wir gemächlich über kalte Steine durch den wunderschön gepflegten Park: Waldwege hoch, über Wurzeln und warme Erde, vorbei an Höhlen und verwunschenen Bäumen. Ich geniesse die Waldluft während ich versuche, mit meinen Gedanken beim Ein- und Ausatmen zu bleiben und mich auf das Anheben und Absenken der Füsse zu konzentrieren. Zurück in der Halle folgt eine Sitz- und Liegemeditation. Dasselbe hier: Beim Einatmen soll man sich innerlich ‚Bud-‘ sagen, beim Ausatmen ‚-dho‘. „Den eigenen Atem, den eigenen Körper zu spüren, ist das Einzige, was man weiss; das Einzige, was uns im Hier und Jetzt hält“, lehren uns die Mönche. „Sobald die Gedanken abschweifen, sind wir nicht mehr im Wissen sondern im Denken. Dann sind wir nicht mehr bei uns.“ Ich mag die Meditation: Einfach hier zu sein, ohne mir Sorgen über Zeit, Zwischenmenschliches oder Unerledigtes zu machen. Und trotzdem: Wirklich weg von Gedanken zu kommen fällt mir sehr schwer, haben wir doch aufregende Wochen hinter uns.
Über Weihnachten und Neujahr waren meine Eltern bei uns zu Besuch. Nachdem sie einige Tage die Traumstrände auf einer Insel im Golf von Thailand genossen, reisten wir zusammen Richtung Norden. Endlich kam ein Moment, auf den ich mich seit unserer Abreise vor zweieinhalb Jahren freute: Bei all dem fremden, exotischen, würzigen Essen, dem wir täglich auf Märkten und in kleinen Restaurants begegnen, muss ich stets an meinen Papa denken. Jedes Mal sehe ich seine glänzenden Augen, wenn an einem Strassenstand wohlriechende Spiessli gegrillt werden, bis er bald darauf freudig reinbeisst und sich die Geschmäcker genüsslich auf der Zunge zergehen lässt. Jedes Mal wünschte ich, ich könnte das Essen mit ihm teilen; ihm zeigen, was wir alles kosten dürfen. Nun war es also endlich so weit und wir probierten uns zusammen durch den Nachtmarkt in Sukhothai, der wunderschön zwischen den Ruinen der alten Königsstadt liegt. Am nächsten Tag war Heiligabend. Wir besichtigten die alten Paläste und Tempel und nachdem sich Papi und ich in hitzigen Diskussionen verstrickten, genossen wir unsere Bescherung zu einem liebevollen Weihnachtsapéro neben exotischen Christbäumen.
Tags darauf reisten wir nach Chiang Mai. Wir schlenderten durch den bezaubernden Nachtmarkt, die schönen Lädeli, kreativen Cafés und unzählige Märkte. Wir sogen die Vielfalt dieser schönen Stadt in uns auf, wobei schon bald das nächste Highlight folgte. Da wir es lieben, die Umgebung mit einem Roller zu erkunden, war die Töfflitour mit meinen Eltern - die erfahrene Motorradreisende sind - umso schöner. Zwei Tage schlängelten wir uns durch die kurvigen Strassen des Doi Inthanon Nationalpark. Riesige Wasserfälle, Blumenfelder in allen Farben und mit sattem Grün überzogene Hügel bewunderten wir, während uns blühende Rhododendren und Büsche von rotem Weihnachtsstern am Wegesrand begleiteten. Wir liessen uns von einem kurzweiligen Besuch in einem Orchideenpark überraschen und staunten nicht schlecht, als uns am nächsten Zwischenhalt, wo wir eigentlich einen Wasserfall besuchen wollten, plötzlich ein Babyelefant gegenüberstand.
So wie meine Gedanken beim Essen zu Papi schweifen, genau so sehe ich Mami vor mir, wenn wir durch verwunschene Wälder streifen, die uns an das Kinderbuch ‚Wo die wilden Kerle wohnen‘ erinnern. Ich stelle mir vor, wie sie ob den Riesenfarnen, den gigantischen Blättern und Bananenblüten nicht mehr aus dem Staunen kommt. Wie sie bei jedem Spaziergang ein Wunder neben dem nächsten sieht und während wir unbeeindruckt weitergehen, holt Mami nochmals tief Luft, schüttelt den Kopf und sagt ungläubig: „Jetzt lug emal die Farn aa, das isch doch verruckt!“.
Erfüllt vom Erlebten kehrten wir nach Chiang Mai zurück und genossen die Neujahrsfeier. Unsere Blicke folgten freudig den bunten Laternen, wie sie in den Himmel stiegen, als wir uns pünktlich zum Jahreswechsel in die Arme fielen.
So sitze ich also da; mit geschlossenen Augen. Es sind nicht die schönen Erinnerungen, die mich daran hindern, bei meinem Atem zu bleiben. Es sind meine Sorgen, dass nicht alle eine vollumfänglich gute Zeit hatten.
Seit unserer Zeit in Lateinamerika setzen wir uns mithilfe der Schematherapie intensiver mit unseren familiären Prägungen auseinander. Auch deswegen freute ich mich, meine Eltern nach so langer Zeit so intensiv wiederzusehen: Ich war gespannt, von welchen negativen Glaubenssätzen ich mich bereits lösen konnte und welche mir noch immer im Weg standen. Und ich war überrascht, wie schnell ich mich für Vieles wieder verantwortlich fühlte. War es für Mami zu langweilig, weil Mirjam und ich so viel Zeit für uns brauchten? War ich in den Diskussionen mit Papi zu offensiv und unfair? Gab ich Mirjam genügend Wertschätzung und Platz?
Zwischen den Meditationen stöbere ich durch die Bücher der Bibliothek und tausche mich mit anderen Reisenden aus; stets auf der Suche nach Sinn und Zweck der Meditation. Dabei stosse ich auf zwei grundsätzliche Ziele. In der Samatha-Meditation steht die Kontrolle des Atems, der Gedanken und des Körpers im Zentrum. Sie soll beruhigen, motivieren und fokussieren. Die Vipassana-Meditation hingegen legt den Fokus darauf, die „Wahrheit des Lebens“ zu kennen. Dabei geht es darum, immer und überall die innere Balance zu finden. Das Gleichgewicht zwischen Selbstlosigkeit und Selbstfürsorge liegt darin, die eigenen Bedürfnisse und Ziele - frei von äusseren Einflüssen und Erwartungen - zu kennen. Ebenfalls sollen eigene Ängste entlarvt und somit realisiert werden, dass diese nicht rational sind. Alles, was in unserem Kopf geschieht, soll beobachtet werden, jede Handlung sollen wir bewusst tun, jedes Wort bewusst sprechen, sodass wir frei von Reue, Zweifel, Stolz et cetera leben können. Etwas ungläubig halte ich inne. Das ist doch dasselbe, das wir seit Monaten dank Schematherapie lernen?
Nach der Meditation findet jeweils eine Fragerunde statt. Heute sitzt uns Alan gegenüber. Er wuchs in Kalifornien auf und lebte dort, bevor er sein bisheriges Leben aufgab und ins Kloster zog. „Unseren Weg, unsere eigene Überzeugung zu finden, unsere Ängste los zu werden - das sind doch alles Ziele, welche jeder reflektierte Mensch verfolgt?“, frage ich ihn. „Was daran ist nun spezifisch Buddhistisch?“ Alan schaut nachdenklich zur Decke. Dann bittet er mich, die Frage zu wiederholen. Ich präzisiere: „Was war deine persönliche Motivation, ein buddhistischer Mönch zu werden, anstatt diesen Zielen in deinem bisherigen Leben nachzugehen?“ Seine Antwort kommt überraschend: „Das Leben als Mönch gibt mir die Möglichkeit, tief in diese Fragen einzutauchen. Hier habe ich dank der Umgebung und dem Austausch mit gleichdenkenden Menschen die Möglichkeit, mich täglich damit auseinanderzusetzen.“ Ich freue mich, wie pragmatisch, statt dogmatisch seine Antwort ist.
Die Zeit im Kloster geniesse ich in vollen Zügen. Ich fühle mich komplett stressfrei, was wohl nicht nur dem Tagesprogramm, sondern auch der wunderschönen Lage in den nebelverhangenen Bergen an der Grenze zu Myanmar geschuldet ist. Zwei Mal pro Tag steht ein veganes Buffet bereit, zu trinken gibt es Tee, Kaffee und leckeren Kakao. Hier vergesse ich sogar, dass ich kein Morgenmensch bin - ganz im Gegenteil: Es ist jeweils noch dunkel, wenn unsere Wecker läuten. Mit kleinen Augen und in Wolldecken eingehüllt, setzen wir uns in der Meditationshalle nebeneinander auf den Boden. Jeder hat einen kleinen Teller voll Reis vor sich, der wohlriechend den offenen Raum erfüllt. Bevor wir uns selbst verköstigen, spenden wir den Mönchen von unserem Essen. Buddhistischen Mönchen ist es weder erlaubt Nahrungsmittel anzubauen, noch Essen selbst zuzubereiten. Es steht ihnen auch nicht zu, selbst zu schöpfen. Sie dürfen nur essen, was ihnen freiwillig gegeben wird. Der Nebeneffekt für uns Nicht-Mönche: Wir üben uns - mit den duftenden, vollen Tellern vor uns - in Geduld bis wir etwas davon abgegeben haben. Das Essen zu teilen und zu merken, dass wir noch immer genug haben, soll uns die Angst nehmen, zu kurz zu kommen. Dass wir zuerst den Geruch wahrnehmen und den gefüllten Teller mit unseren Augen wertschätzen, lässt uns das Essen noch mehr geniessen.
Die heutige Meditation und Fragerunde wird vom thailändischen Mönch Phra Anek geleitet. Gespannt lausche ich seinen Ausführungen. Ich bin fasziniert, wie er die Kunst der Selbstbeherrschung und Reflexion so herunterbrechen kann, dass wir sie verstehen. Und ich darf heute lernen, dass es auch unter den Mönchen verschiedene Ansichten oder Schwerpunkte gibt. Bei Phra Aneks Ausführungen steht die Wiedergeburt im Zentrum: Hast du genügend gebetet und meditiert, hast du deinen Geist beim Zeitpunkt des Todes so weit von allem Irdischen befreit, wirst du aus dem Kreislauf der Wiedergeburt erlöst. „Alles Essen, welches wir während unserer Zeit auf der Erde an Mönche spenden, kommt in gleicher Form zu uns zurück, wenn wir unseren Körper verlassen“, so Phra Anek. Spendet man also leckere, warme Gerichte, bekommt man eben diesen Gaumenschmaus zurück. Spendet man trockenes Brot, so müsste man sich nach dem Tod ebenfalls damit zufriedengeben. Ich sitze etwas ernüchtert auf meinem Sitzkissen. Was soll daran nun selbstlos sein, wenn die Motivation des Gebens schlussendlich das Bekommen ist? Ich merke, dass mein kultureller Hintergrund wohl eher dem von Alan entspricht. Dass mich seine Schwerpunkte, seine wissenschaftlichen Erklärungen mehr ansprechen und dass ich diese mitnehmen kann, ohne mich an den anderen - für mich unlogischen - Theorien stören zu müssen.
Mehr und mehr kann ich mich also auch auf die religiösen Rituale einlassen. Die dhamma talks nutze ich, um meine Dankbarkeit für das leckere Essen auszudrücken, um mich vor den Bäumen zu verneigen und mich zu bedanken, dass sie uns täglich mit hübschen Blumen und leckeren Früchten versorgen. Solange ich mit meinen Gedanken bei mir bin, kann ich mich auch vor meinen persönlichen Anliegen verneigen: Denke ich an eine Auseinandersetzung, versuche ich mein Gegenüber zu verstehen. Das nimmt mir den Groll. Auch die Sprechgesänge mache ich nun mit. Es kümmert niemanden, so kümmert es auch mich nicht und ich geniesse die Vibrationen der tiefen, monotonen Töne, wie sie meine Atmung anregen. Und ich spüre, wie mein Wiederstand und die Ablehnung von Silbe zu Silbe verfliegt.














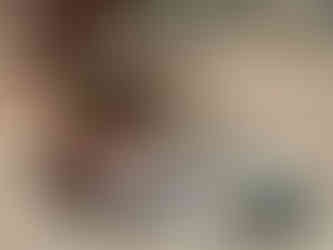













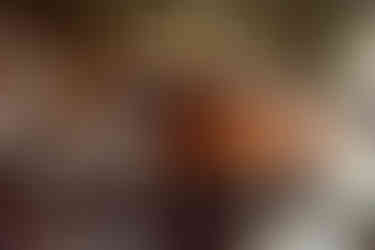




































































Kommentare